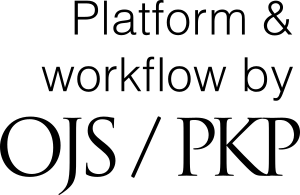Richtlinien
HINWEISE ZUR ABFASSUNG VON REZENSIONEN IM GNOMON
Stand: 09. September 2025
1. SACHLICHES
Als kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft soll der Gnomon die Verbindung zwischen den einzelnen Disziplinen der Altertumswissenschaft pflegen. Er will die Möglichkeit bieten, sich gerade auch in den Nachbarfächern zu orientieren. Die Rezensierenden sprechen vor einem Publikum, das aus allen Gebieten unserer Wissenschaft kommt.
In erster Linie soll jede Rezension ein klares Bild vom Inhalt des Buches geben, das auch denjenigen verständlich ist, die das Buch und das behandelte Problem nicht aus eigener Anschauung kennen. Der wissenschaftliche Charakter der Rezension wird oft Einzelkritik erfordern; das bloß Spezialistische soll aber nicht überwiegen und nicht so sehr um seiner selbst willen als zur Illustration von Methode und Ergebnis des Buches herangezogen werden. Alles Spezielle soll von dem allgemein Bedeutsamen in klarer Gliederung getrennt geboten werden.
Der Gnomon legt Wert auf eine gut lesbare, sprachlich saubere Form. Als Sprachen sind im Gnomon zugelassen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Lateinisch. Für Beiträge in deutscher Sprache gilt die Neue deutsche Rechtschreibung. Für Beiträge in anderen Sprachen gelten entsprechende Vorgaben.
Eigene produktive und weiterführende Beiträge zum Gegenstand sind sehr erwünscht. Für sonst nicht verwertbare Stoffsammlungen hat der Gnomon keinen Platz.
Auf Druckfehlerverzeichnisse oder Berichtigung bloßer Einzelversehen bitten wir im Allgemeinen zu verzichten. Aufgabe des Rezensierenden sollte es sein, das Wesentliche hervorzuheben und alles Kleinliche durch Stillschweigen oder, wenn nötig, durch ein kurzes Wort abzutun.
Erwiderungen werden im Gnomon nicht aufgenommen. Dieser Grundsatz schützt die Rezensierenden und die Leserschaft vor meist unerfreulichen Debatten. Er legt aber den Rezensierenden die Pflicht auf, für eine verantwortliche Zurückhaltung in der Formulierung negativer Urteile Sorge zu tragen. Selbstverständlich muss ferner den Verfassenden des rezensierten Werkes das Recht auf eine Richtigstellung gewahrt bleiben, wenn nachgewiesen wird, dass Beanstandungen gemacht wurden, die rein faktisch unzutreffend sind; in einem solchen Falle werden möglichst die Rezensierenden selbst in der Form der Berichtigung den Irrtum zurücknehmen.
2. TECHNISCHES
2.1 Manuskript
2.1.1 Einreichung
Reichen Sie bitte Ihre Texte über unsere Website gnomon.uni-bonn.de ein. Einen Zugang haben Sie bei der Zusage zur Rezension durch uns erhalten.
Die Schriftleitung bittet ausdrücklich darum, die Gnomon-Musterdatei zu verwenden. Diese erhalten Sie zusammen mit der Zusage zur Rezension als Anhang per E-Mail. Außerdem steht sie zum Download bereit auf: https://www.gnomon.uni-bonn.de/about/submissions
Durch Verwendung der Musterdatei wird die Arbeit des Lektorats erheblich vereinfacht und die Zeit zwischen Eingang einer Rezension und ihrer Veröffentlichung kann dadurch verringert werden.
Bitte laden Sie Ihr Manuskript unter einem Dateinamen nach folgendem Muster hoch:
(Rezensierende*r) - (Verfassende*r des rezensierten Bandes).docx
2.1.2 Formatvorgaben
In der Musterdatei sind folgende Einstellungen bereits vorgenommen:
Als Schriftart verwenden Sie bitte ‘EB Garamond 12’. Der Haupttext weist eine Schriftgröße von 10,5 pt und einen Zeilenabstand von genau 11,25 pt auf. Die Fußnoten weisen eine Schriftgröße von 9,5 pt mit einem Zeilenabstand von genau 9,6 pt auf. Haupt- und Fußnotentext stehen im Blocksatz. Einzüge von Absätzen haben eine Breite von 0,3 cm. Auf Leerzeilen zur Trennung von Absätzen bitten wir zu verzichten. Die Laufweite des Textes muss um 0,1 pt reduziert werden. Bitte verzichten Sie außerdem auf manuelle Wort- und Silbentrennung.
Achten Sie darauf, dass Ihr Manuskript an den Rändern sowie an den Ober- und Unterkanten folgende Maße aufweist: links: 5,00 cm, rechts: 4,40 cm, oben: 5,00 cm, unten: 5,75 cm. In der Musterdatei sind alle Einstellungen bereits vorgenommen. Einzelne Teile, die bspw. als ergänzende Bemerkungen der Rezensierenden oder Detailausführungen gewertet werden können, sollten in kleinerer Schriftgröße (petit) gesetzt werden. Dafür werden Schriftgröße und Zeilenabstand wie bei Fußnoten gewählt.
2.1.3 Rahmen einer Rezension
Zu Beginn stehen die bibliographischen Angaben des rezensierten Titels. Die Form kann ebenfalls unserer Musterdatei entnommen werden.
Die Verfassenden werden mit ausgeschriebenen Vor- und Nachnamen in fett aufgeführt. Darauf folgt ggf. die Angabe Hg. bzw. Hgg. und ein Doppelpunkt. Titel und Untertitel werden mit einem Punkt getrennt. Wenn es sich um einen antiken Werktitel handelt (auch in Übersetzung), wird er kursiv gesetzt.
Auf den Titel und ggf. Untertitel folgt der Erscheinungsort, der Verlag, das Erscheinungsjahr und der Seitenumfang. Falls der Titel Teil einer Reihe ist, wird die Reihe zum Schluss in Klammern angegeben. Abkürzungen wie Hg./Hgg., S., Abb. usw. werden in der Sprache des Buches angegeben z.B.
Philip Aubreville: Der Hass im antiken Rom. Studien zur Emotionalität in der späten Republik und frühen Kaiserzeit. Stuttgart: Steiner 2021. 356 S. (Historia. Einzelschriften 266).
Cyril Courrier, Julio Cesar Magalhães de Oliveira (eds.): Ancient History from Below. Subaltern Experiences and Actions in Context. London/New York: Routledge 2022. XXVIII, 292 pp. 14 fig. (Routledge Monographs in Classical Studies 9).
Jérôme Moreau, Olivier Munnich (éds.): Religion et rationalité. Philon d’Alexandrie et sa posterité. Leiden/Boston: Brill 2021. VI, 297 p. (Studies in Philo of Alexandria 11).
Simonides: Epigrams and Elegies. Edited with Introduction, Translation, and Commentary by David Sider. Oxford: Oxford UP 2020. IX, 467 pp.
Lucano: Bellum Civile VIII. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di Alessio Mancini. Berlin: De Gruyter 2022. VII, 582 p.
Am Schluss der Rezension fügen Sie bitte Ihren Wirkungsort in recte linksbündig und Ihren Namen in kursiv rechtsbündig ein. Dafür kann die unsichtbare Tabelle am Ende der Musterdatei verwendet werden z.B.
|
Bonn |
Die Schriftleitung |
Verzichten Sie bitte auf sonstige Angaben wie Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse.
2.1.4 Anmerkungen
Nebenbemerkungen, Belege, längere Verweise werden der Übersichtlichkeit willen in Fußnoten gestellt, die durchzuzählen sind. Bei Rezensionen, die als ‘Vorlagen’ vorgesehen sind, sollte nach Möglichkeit auf Fußnoten verzichtet werden. Auf Querverweise ist grundsätzlich zu verzichten. Zur Besprechung hinzugezogene Titel werden nach dem folgenden Muster zitiert:
Monographien:
Roelof van den Broeks: The Myth of the Phoenix. According to Classical and early Christian Traditions. Leiden 1972.
Tagungs- und Sammelbände:
Nikolaus Dietrich: Nacktheit, Gewand und der Körper in der antiken Plastik. Mit Herder contra Herder. In: Nicole Hegener (Hg.): Nackte Gestalten. Die Wiederkehr des antiken Akts in der Renaissanceplastik. Petersberg 2021, S. 19–24.
Zeitschriften:
Ezio Pellizer: Simonide κίμβιξ e un nuovo trimetro di Semonide Amorgino. In: QUCC 38 (=N.S. 9), 1981, S. 47–51.
Bei erneutem Verweis auf einen bereits aufgeführten Titel soll ein aussagekräftiger Kurztitel verwendet werden. In Klammern wird dann auf die erste vollständige Nennung des Titels verwiesen z.B. Pellizer: Simonide κίμβιξ 1981, S. 48 (vgl. Anm. 2).
2.1.5 Umfang von Beiträgen
Der Raum im Gnomon ist sehr beschränkt. Umfangreiche, mehr als acht Druckseiten füllende Rezensionen kommen nur für wirklich zentrale Gegenstände in Frage. Daher sind äußerste Beschränkung und Komprimierung erforderlich. Hält der Rezensierende einen größeren Umfang als den bei der Aufforderung zugebilligten für notwendig, so wird darum gebeten, sich vorher mit der Schriftleitung zu verständigen. Der Abdruck überlanger Rezensionen ohne vorherige Absprache kann nicht garantiert werden.
Die Angaben der Redaktion zur Länge der Manuskripte beziehen sich auf Seiten im Umfang von jeweils 3.500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) pro Seite.
Die Kurzanzeige (Vorlage) im Petitteil (insgesamt bis etwa 12.000 Zeichen [inkl. Leerzeichen]) ist eine kürzere Form der Besprechung, die in knappster Form die Argumentation eines Buches kritisch wiedergibt.
2.2 Drucktechnisches
Erforderliche Zeichen wie etwa verschiedene Arten von Anführungszeichen und Halbgeviertstriche finden Sie zum Kopieren (Windows: Strg+C; Mac: Cmd+C) und Einfügen (Windows: Strg+V; Mac: Cmd+V) in unserer Musterdatei.
2.2.1 Zitierweise
Antike Werktitel (auch in Übersetzung) stehen kursiv, moderne (auch lateinische) in gnomischen (‘ ’) Anführungszeichen. Die gilt sowohl für Buchpublikationen als auch für einzelne Artikel oder Kapitel. z.B. ‘in Thukydides’ Peleponnesischer Krieg kommt der Figur des Nikias eine besondere Bedeutung zu’; im Kapitel 2 ‘Die weitere Entwicklung’ usw.
2.2.2 Hervorhebungen
Als Hervorhebung ist ausschließlich Kursivierung zulässig (also kein Fettdruck, keine Kapitälchen usw.).
2.2.3 Anführungszeichen und Apostroph
« » ohne Leerzeichen zwischen Anführungszeichen und Buchstaben werden nur für wörtliche Zitate aus modernen Texten – auch aus dem rezensierten Werk – verwendet. Bei direkten Zitaten ist die Angabe der Fundstelle (z.B. Seitenzahl) zwingend erforderlich. Außerdem werden diese Anführungszeichen für Wortbedeutungen und Übersetzungen verwendet z.B. statio «Gottesdienst»
‘ ’ (gnomische Anführungszeichen werden zum Ausdruck von ‘sogenannt’, zur Pointierung eines Wortes u. dgl. verwendet (z.B.: in ‘die Cäsaren’, die ‘deteriores’, die ‘Antiquitäten’).
Doppelte Anführungszeichen werden grundsätzlich nicht verwendet (außer sie befinden sich in direkten Zitaten z.B. aus dem rezensierten Werk).
Bei der Verwendung von Apostrophen ist darauf zu achten, dass ’ (in sog. ‘Neunerstellung’) verwendet wird. Insbesondere bei Sprachen, die regelmäßig apostrophieren wie etwa das Italienische oder Französische, ist darauf zu achten, z.B. l’Arpinat, dell’antichità.
2.2.4 Klammern
Korrekturzusätze stehen in eckigen Klammern. Eckige Klammern stehen auch bei Klammern in bereits eingeklammerten Abschnitten. z.B. ‘(bis etwa 12.000 Zeichen [inkl. Leerzeichen])’
2.2.5 Römische Ziffern
Bei praefationes werden zur Angabe von Seitenzahlen römische Ziffern übernommen und großgeschrieben. Jahrhundertzahlen, Buchzahlen (bes. antiker Texte), Zeitschriftenbände, Abbildungs- und Tafelzahlen zählen Sie bitte arabisch. Dies gilt auch dann, wenn die zitierten Werke selbst römisch nummerieren.
2.2.6 Bindestriche
Es ist zwischen dem Bindestrich (-) und dem Halbgeviertstrich (‒) zu unterscheiden. Der Bindestrich wird zur Wort- und Silbentrennung oder zur Verbindung von Begriffen z.B. Namen verwendet (z.B. Kühner-Gerth). Zur Angabe im Sinne von ‘bis’ wird der Halbgeviertstrich (‒) verwendet z.B. ‘S. 117‒143’ oder ‘in den Jahren 27‒8 v. Chr.’
2.2.7 Seitenzahlen, Zeilenzahlen, Verszahlen
Zwischen der Abkürzung (S., Z. oder V.) oder der Ziffer steht ein Punkt und ein geschütztes Leerzeichen (Windows: Shift+Strg+Leerzeichen; Mac: Alt+Leertaste).
2.2.8 Kommata
Einzelne Glieder einer Zitatreihe, die auf gleicher Stufe stehen, werden durch Punkte (nicht Semikolon oder Komma) voneinander getrennt: Das Komma trennt Band und Seite, Seite und Zeile, Buch und Paragraph z.B. Cic. or. 1,2,3.5 heißt Buch 1, Kapitel 2, Paragraphen 3 und 5. Diese Regeln gelten auch dann, wenn in den zitierten Werken andere Zitiermethoden befolgt werden.
2.2.9 Abkürzungen
Zweite Auflage durch hochgestellte Zahl vor der Jahresangabe, z.B. 21992
‘Anmerkung zwei’ wird durch ‘Anm. 2’ abgekürzt.
folgende = f. oder ff. (oder sq. sqq.) wird nicht verwendet. Stattdessen werden immer die konkret betroffenen Seiten angegeben z.B. S. 117‒143 (nicht 117‒43). In deutschen Beiträgen werden auch deutsche Abkürzungen verwendet. Abkürzungen, die mehrere Worte zusammenfassen, stehen ohne Leerzeichen also: vgl. (nicht cf.). Abb. (nicht fig.). Taf. (nicht pl. tav.). Nr. (nicht No. nr.). Handschrift(en) = Hs(s), ohne Punkt. Fr. (nicht fr. oder Frgm.). Verf. und Jh. (so auch in den obliquen Kasus). a.a.O. (nicht l.c.). Seite = S. (nicht p.). Für in Englisch, Französisch oder Italienisch geschriebene Rezensionen gelten die dort üblichen Abkürzungen.
2.3 Korrektur
Änderungen des ursprünglichen Wortlautes müssen wegen der hohen Kosten auf das Äußerste beschränkt werden. Werden in der Zeit zwischen Satzbeginn und Druck Änderungen unabweisbar, so wird gebeten, sie möglichst in Form von Zusätzen (als Anmerkungen) zu geben, da dies in den Satz am wenigsten eingreift. Eine zweite Korrektur ist auf Wunsch der Rezensierenden bei schwierigem Satz im Umbruch möglich und mit der Schriftleitung zu vereinbaren.
2.4 Sonderdrucke
Sie erhalten eine pdf-Datei Ihres Beitrags vom Verlag C.H.Beck per E-Mail.